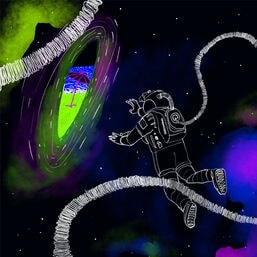- • Startseite
- • Ausgehen
-
•
Alle Clubs geschlossen: Ein Streifzug durch ein seltsames Berlin
Ich wäre gerne halb nackt, vom Gürtel aufwärts, so will ich im Club zwischen anderen Halbnackten tanzen. Vielleicht könnte ich mir auch etwas Löchriges anziehen, ein Netz-Hemd oder etwas aus Leder. Wobei, das ist nicht so meins … oder doch? Das ist ja die Sache: Ich habe es nie ausprobiert.
Seit fast einem Jahr sind die Clubs in Deutschland und großen Teilen der Welt geschlossen. Statt zu tanzen, laufe ich die leeren Gehsteige Berlins entlang. Kottbusser Tor, halb elf abends, ich vergrabe mein Kinn im Kragen meines Anoraks.
Der Club meiner Träume ist das KitKat, Freund*innen erzählen mir von schrägen Menschen in schrägen Outfits, Partys von Freitag bis Sonntag und: von einem Pool. Im Club. Vor einem Jahr noch hätte mich der Gedanke abgestoßen, mit besoffenen Fremden in ein Wasserloch zu springen. Jetzt kann ich mir kaum etwas Schöneres vorstellen.
Uns jungen Menschen fehlt etwas Essenzielles
Anfang 2021, bei täglich fast 1000 Corona-Toten allein in Deutschland, sind solche Partys undenkbar. Man hält sich an die Regeln, verzichtet. Doch gleichzeitig wird unterschätzt, dass uns jungen Menschen dadurch kein Luxus, sondern etwas Essenzielles fehlt: dummes Zeug machen, weil es Spaß macht, weil es egal ist, was morgen ist. Versuchen, fehlschlagen, herausfinden, wer man sein kann, bevor die Welt einen mit Arbeit und Verantwortung überschüttet. Was bleibt davon in einer Pandemie? Auf einem Spaziergang durch Berlin will ich der Antwort näherkommen.
Ich steige in den Bus zur Warschauer Straße, drei weitere Personen, etwa in meinem Alter, sitzen verteilt in den anderen Reihen. Niemand spricht, es ruckelt und zischt. Draußen unterhalten sich ein paar Männer mit großem Abstand zueinander vor einem Backwarenladen, ein Junge und ein Mädchen stehen eng zusammen auf dem Gehweg, eine Kreuzung weiter sind vor einem Rewe rund zwei Dutzend Polizist*innen im Blaulicht erstarrt. Sie scheinen darauf zu warten, dass etwas passiert.
Als ich im Oktober 2019 für das Studium von München nach Berlin zog, wusste ich nicht, dass mir nur rund fünf Monate blieben, um das Berlin zu erleben, das ich mir ausgemalt hatte. Seit einer Klassenfahrt hatte mich Berlin angezogen, wie Wurzeln Wasser ziehen. Es versprach ein aufregendes Leben weit weg von zuhause. Ich wollte mir die Haare blond färben, ein Tattoo stechen lassen, in Clubs gehen, die meine Münchner Freunde nur aus Geschichten kannten. Eilig hatte ich es nicht. Zuerst schlürfte ich Cocktails in Bars, traute mich erst in kleine, bald in größere Clubs. Ins KitKat wollte ich erst, wenn ich mich bereit für das „richtige Berlin“ fühlte. Das Sysyphos und das Berghain sollten folgen. Vor mir lagen schließlich mindestens sechs Semester, in denen ich mich ausprobieren konnte. Dachte ich.
Als Neuberliner die Gegend erkunden
Die Gegend um die Warschauer Straße ist vollgepackt mit Clubs und Bars. Schon an der S-Bahn-Station wummern Raves, verrenken sich Menschen im Beat, normalerweise. Zehn nach elf Uhr. Ich steige die Stufen einer Stahltreppe hinab zum Clubgelände und stehe unten angekommen in einem wirklich miserablen Museum, so kommt es mir vor. Clubs, Bars und Jugendzentren liegen hier unbeachtet wie Tonscherben in einer „Geschichte der Menschheit“-Ausstellung. Besucherzahl: 1. In einer Ecke finde ich das „Schmutzige Hobby“, an dessen Wand alte Veranstaltungsposter kleben. Es war der erste Club, den ich als Neuberliner besuchte und vor dem ein bulliger Türsteher mich fragte, ob ich schwul sei. Ja? Supi, komm rein.
Berlin ist anders als München. Wunderbar anders. Homo, bi, cis, trans, queer – im Nachtleben der Stadt bin ich einer von vielen, gerade als schwuler Mann. Da kann meine Heimatstadt mit nur einem guten Schwulenclub, der an nur einem Tag der Woche – einem Mittwoch – geöffnet hat, einfach nicht mithalten. Die Berliner Szene ist für viele ein Safer Space, für mich heißt das: ein Ort, an dem mich niemand aufgrund meiner Sexualität verurteilt. Es fühlt sich nach Geborgenheit an, zwischen Menschen zu tanzen, von denen ich weiß, dass sie entweder auch queer sind oder Heteros, die einfach mitfeiern wollen. Im „Schmutzigen Hobby“ mischte ich mich einfach allein unter Fremde.
Jetzt ist der Club zum Teil mit Planen zugedeckt. Das „Schmutzige Hobby“ und die ganze Szene liegen auf unbestimmte Zeit im Koma. Zuletzt mutmaßte der Dachverband Clubcommission Berlin, das Nachtleben kehre wohl erst Ende 2022 so richtig zurück. Zwei Jahre kein Partyleben. Es ist, als würde ich einen Teil von mir wieder wegsperren, den ich nur mühsam aus einer Kammer befreit hatte. Ich bin stolz, dass ich offen als schwuler Mann lebe und ich will das auf Pride-Paraden und in Clubs feiern, nachholen, was ich in meiner Teenagerzeit verpasst habe, während Tim und Lisa knutschten. Doch – egal, ob homo oder hetero – der Spielplatz, auf dem wir uns ausprobieren, ist für alle gesperrt. Hilft nichts.
Ich fahre weiter Richtung Süden. In der Bahn sitze ich neben einer Sektflasche, 0.2 Liter, von irgendjemandem ausgetrunken. Keine Ahnung, warum, aber sie muntert mich auf. In guten Momenten phantasiere ich, wie es wohl sein wird, wenn die Pandemie endlich vorbei ist: Alle rennen auf die Straßen, die Sonne scheint, Masken und Sektkorken fliegen, wir liegen uns in den Armen und tanzen, holen alles nach, sind einfach zwei Jahre länger jung. Clubs werden boomen. Weil alle nur eines wollen: feiern.
Bodinstraße, kurz vor zwölf, das SchwuZ. Vergangenes Jahr im Februar war ich in dem Szeneclub und staunte über die lange Schlange und die vielen Tanzenden auf drei Floors: Techno, Oldies und Pop – so viele Menschen in einem Schwulenclub. Jetzt muss ich erst eine Weile nach dem Eingang suchen und finde erst mal Bücher auf einem Baugerüst. Der Titel des einen ist „The subtle art of not giving a f*ck“, auf einem anderen steht „Gastro.Startup.Berlin“. Hat wohl jemand nicht mehr gebraucht.
„Und mir wird klar, dass ich ganz allein, kurz nach Mitternacht, vor einem verlassenen Club stehe“
Dann finde ich es doch: „SchwuZ“ steht auf einer schmalen Tür, die sich in einer dunklen Ecke neben zwei Garagentoren versteckt. Musik! Ich höre Musik hinter den Garagentoren und durch eine Scheibe fällt Licht. Als ich näherkomme, sehe ich, dass dahinter eine Art Werkstatt liegt, auf einem Podest steht ein Motorrad. Niemand ist zu sehen. Dann höre ich Metall, das auf Metall schlägt. Und mir wird klar, dass ich ganz allein, kurz nach Mitternacht, vor einem verlassenen Club stehe. Wenn man 2021 möglichst unbemerkt jemanden umbringen will, empfehle ich den Tatort Clubgelände.
U-Bahn Richtung Heinrich-Heine-Straße. Es ist deprimierend. Ich bin regelrecht vor einem Ort geflohen, der für mich vor einem Jahr noch ein Safer Space war. In schlechten Momenten denke ich daran, dass man die Jugend nicht mal eben nachholen kann. Kindergeld endet, Bafög-Schulden häufen sich, und während wir versuchen nicht erwachsen zu werden, zahlen wir plötzlich Steuern, statt sie zu bekommen.
Ich war nicht im KitKat, habe kein Tattoo und keine blonden Haare, obwohl Friseure ja zwischendurch mal offen hatten. Nur einen Schnauzbart habe ich mir mühevoll gezüchtet. Manchmal denke ich, vielleicht hätte ich es machen sollen wie ein paar meiner Freunde, die in den ersten Uni-Wochen in die größten Clubs rannten und selbst im vergangenen Sommer, als die Coronazahlen niedrig waren, zu nicht immer legalen Partys gingen.
„KitKat“ - Zentrum für Corona-Schnelltests
Jetzt rattert die U-Bahn mich zum KitKat, ein Jahr zu spät. Zu allem Überfluss steigt ein Mann zu, der laut „Play With Fire“ von Nico Santos hört. Das ist, was übrig bleibt, denke ich. Von der Partywelt Berlin bleibt eine Musikbox, aus der Nico Santos dröhnt.
Halb eins. Als einziger steige ich aus und gehe zum KitKat. Momentan ist es ein Zentrum für Corona-Schnelltests. Wie viele Menschen hier wohl ein positives Testergebnis erhalten und sich danach zuhause verbarrikadiert haben? Wie viele Leben wir wohl alle schon gerettet haben und noch retten werden, eben dadurch, dass wir nicht feiern gehen? Ich stehe vor dem Tor des KitKat-Clubs. Dahinter, im Dunkeln, liegt eine Art Hof. Ob da der Pool ist? Ich springe, um über das Tor sehen zu können, so hoch ich kann. Aber alles, was ich sehe, ist ein Schild, auf dem steht „Life is a Circus“.
Das ist so absurd, dass ich lachen muss. Ich will nur noch heim, gehe zurück zur U-Bahn, mache dann doch einen Umweg zur Brücke am Märkischen Museum. Über der Spree erhebt sich die Skyline Berlins. Im Wasser liegen mit Schnee bedeckte Boote. Ein Uhr nachts, kein Mensch hier. Berlin schläft. Wenn nach Corona alles aufwacht, werde ich da sein. In den Clubs, auf den Tanzflächen, und ich werde abschütteln, was die Pandemie uns jungen Menschen zu früh auferlegt hat: Verantwortung. Ich löse meinen Blick vom Nachtpanorama der Stadt. Es ist wohl das Beste, wenn ich auch schlafen gehe.