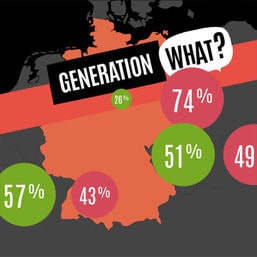- • Startseite
- • Europa
-
•
Europa, bist du noch zu retten?
Europa ist wie ein Fahrrad, hat mal jemand gesagt. Tritt man nicht ständig in die Pedale, ziehen es die Erdanziehungskräfte zu Boden. Entweder es fährt. Oder es fällt um.
Diese Kräfte sind momentan so stark wie nie. Fast überall in Europa wachsen Bewegungen, die raus aus der EU wollen. In England steigen sie schon aus, in Polen und Ungarn nehmen sie Kurs. In den Niederlanden und Frankreich sind sie nah dran. Und in der Türkei, schon lange ein sehr interessierter und wichtiger EU-Anwärter, regiert ein europafeindlicher Despot. Die EU, die einst für Reisefreiheit, Völkerfreundschaft, Zukunft stand, wirkt heute auf mich wie das sprichwörtliche sinkende Schiff, das die Ratten verlassen.
Was macht das mit uns? "Ich fühle mich beim Thema EU wie ein angehendes Scheidungskind“, schrieb die Kollegin Charlotte Haunhorst vor einem knappen Jahr. Seitdem ist es nur schlechter geworden. Und 2017 ist ein Superwahljahr: Niederlande, Frankreich, Tschechien, Deutschland wählen. Spätestens seit dem Brexit-Referendum frage ich mich: Ist die EU schon erledigt – und man sagt es uns nur noch nicht? Ist Europa kaputt? Und wer ist schuld?
Jeder für sich, keiner für alle
Als Geert Wilders, Chef und einziges Mitglied der europafeindlichen PVV ("Partij voor de Vrijheid“, Partei für die Freiheit) im Sommer 2016 sein Programm für die kommende Wahl veröffentlichte, musste man nicht lange lesen. Seine Politik passte auf eine DIN-A4 Seite. „Die Niederlande gehören wieder uns“, lautet das Motto. Neben einer deutlichen Anti-Islam-Politik fordert Wilders: den Austritt aus der EU.
Nationalstaat statt EU, vermeintliche Identität statt internationaler Brücken – auch wenn die auf Handel angewiesenen Niederlande sehr darunter leiden würde. Man könnte Wilders, die Brexit-Befürworter rund um die englische Premierministerin Theresa May oder auch Frankreichs Marine Le Pen wie in einem Erasmus-Programm für rechte Politiker einmal international durchtauschen lassen – die Inhalte blieben die gleichen. All diese Nationalisten und Rechtskonservativen wollen raus aus der EU. Doch wieso erstarken diese Kräfte gerade jetzt? Und wie gefährlich sind sie?
„Die EU ist nicht krank in Brüssel. Sondern eher in Paris und Berlin und Rom"
„Europa ohne Frankreich ist nicht denkbar“, sagt mir Eva Heidbreder, Professorin am Jean-Monnet-Lehrstuhl für europäische Integration der FU Berlin. „Wenn Marine Le Pen nach einem Wahlsieg wirklich den Austritt anstrebt, ist die EU ganz einfach nicht mehr handlungsfähig“.
Zwar hat die EU-skeptische Fraktion im Parlament aktuell „nur“ 45 Mitglieder – von insgesamt 751. Aber stellen wir uns mal vor, im Bundestag säßen 30 Abgeordnete, die den Bundestag abschaffen wollen? Und die in den Bundesländern dafür Mehrheiten bekommen?
Heidbreder erklärt mir, das Erstarken dieser Nationalisten sei „das Ende des Honeymoons nach dem kalten Krieg.“ Wir Wendekinder seien in dem Glauben aufgewachsen, der Westen und damit die liberale, rationale Demokratie habe gewonnen. "Dass aber jemand sagt: Meine Politik soll gar nicht auf Fakten und Ausgleich beruhen, sondern auf meiner Wahrnehmung und allein dem, was ich will“, so Heidbreder, „das war bisher nicht üblich. Gewisse Werte waren gesetzt.“ Der leider erfolgreiche Stil der Brexit-Befürworter, explizit Daten und Fakten in der Kampagne abzulehnen, lässt uns ratlos zurück. „Inwieweit heute autoritäre, illiberale Herrschaft die Überhand gewinnt, wie in Ungarn oder Polen, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass genau solche Herrschaft mit der DNA der EU nicht vereinbar ist."
Dieser europafeindliche Populismus kann nicht durch nationale Antworten eingefangen werden. "Die EU ist nicht krank in Brüssel“, sagt Heidbreder. „Sondern eher in quasi allen Hauptstädten. Nationale Politiker spielen immer wieder die gleiche Karte: 'Dort die EU, hier wir'. Und in der Presse steht dann: 'Wir zahlen für die EU'. Diese falsche Problembeschreibung verhindert eine echte Problemlösung. Und bedient einen Populismus, der daraus 'EU schlecht, wir gut' macht.“
Aber was kann man dagegen tun, dass die EU immer der Sündenbock ist? Und stimmt das überhaupt? Mangelt es der EU nur an der „Verkaufe“? Mehr Fragen als EU-Verordnungen, scheint es.
"Das Fahrrad ist schon lange umgefallen"
Eine, die Antworten weiß, ist Ulrike Guérot, Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Ihr Assistent wimmelt mich erst ab, die Professorin sitze an einem neuen Buch, Endphase, nicht erreichbar. Aber sie meldet sich doch, morgens um halb neun, außer Atem. „Europa ist mein Lebensthema, natürlich rege ich mich auf.“ Schon 1992 war sie als Mitarbeiterin von Wolfgang Schäuble am Maastrichter Vertrag beteiligt, mit dem die EU, wie wir sie kennen, überhaupt erst begann. Ihr neues Buch, "Der europäische Bürgerkrieg – Europa zwischen Ungeist und Humanismus“, beschäftigt sich genau damit: Was ist kaputt? Und wie reparieren?
Über den Fahrradvergleich kann Guérot nur bitter lachen. „Das Fahrrad Europa ist längst umgefallen. Wir haben's nur nicht gemerkt.“ Die Franzosen hätten schon 2005 gegen Europa gestimmt, beim Referendum zur EU-Verfassung, "nachdem sie mental und emotional ausgestiegen waren.“ Kurze Zeit davor schon die Niederländer. Von 1998 an zählt Guérot Ereignisse auf, durch welche die EU immer tiefer in die Krise schlitterte. Ihr Schluss: „Spätestens 2012 war die EU erledigt.“
Doch das wollte keiner hören. „In der Spaßmoderne, in der junge Menschen wie Sie hineingeboren wurden, mit Berlin und Techno, dazu Sommermärchen und Exportweltmeister, alles schick und schön – da hat man im Bereich Bildung und Politik viel verpasst.“ Die europäische Erzählung sei verschwunden, schon vor der „sogenannten Euro-Krise, die eigentlich eine Bankenkrise war.“
Der europäische Bürgerkrieg, von dem Guérot in ihrem Buch spricht, findet nicht zwischen Nationen, sondern zwischen oben und unten statt, zwischen arm und reich. „Dass sich jetzt viele Menschen den Rechtspopulisten zuwenden – Orban, Wilders, Le Pen – alle nur eine logische Folge der sozialen Enttäuschungen der letzten Jahrzehnte.“ Auf diese Entwertung des Einzelnen, paraphrasiert sie Elias Canetti, kann der Mensch sich nur wehren, indem er sich eine Masse, ein Kollektiv sucht, zu dem er gehört. Was heute meistens heißt: rechte, nationalistische, völkische Bewegungen.
Beispiel Ungarn: „2004 kam Ungarn in die EU. 2008 sollten sie den Euro bekommen. In der Hoffnung hatte sich die ungarische Mittelschicht mit Euro-Krediten Häuser gekauft. Dann: Bankenkrise. Und die Mittelschicht musste die Kredite in Forinth zurückzahlen. Wissen Sie, wie weh das tut? Und dann kommt Orbán und sagt: weg mit der EU! Da müssen Sie gar kein Rassist oder irgendwas sein, da wählen Sie den.“ In Polen lief es ähnlich, auch die Griechen, alle fühlen sich laut Guérot nur als „second class Europeans.“
Und auf diesen „demokratischen Mehltau“ fiel dann 2015 – „eigentlich, wenn man die Italiener fragt, schon lange vorher, aber das hat uns nicht interessiert“ – die sogenannte „Flüchtlingskrise". "Und auf einmal schafft Angela Merkel das Abkommen 'Dublin II' zur Verteilung von Flüchtlingen ab. Und die anderen merken: Europa, das ist also, wenn Deutschland bestimmt, wie es läuft."
Ich merke: In einer guten Stunde hat Ulrike Guérot mir mehr über die EU vermittelt, als die letzten Jahre Zeitungslektüre. Und das ist genau das größte Problem, findet sie: „An vielen Gymnasien, musste ich feststellen, wissen die Schüler nicht mal mehr genau, was die EU überhaupt ist.“ Niemand habe sich gekümmert, was alles schief lief, bis jetzt. „Und jetzt rufen alle an und wollen wissen, was los ist mit Europa. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Der Teich EU muss wahrscheinlich erst einmal umkippen, bevor neuer Sauerstoff entstehen kann“, sagt sie.
„So sehr kann man sich nicht irren!"
Aber wie kurz vorm Umkippen ist dieser Teich? Ich rufe einen an, der länger als jeder andere darin geschwommen ist: Daniel Cohn-Bendit, glühender Europäer, Buchautor ("Für Europa!"), von 1994 bis 2014 für die Grünen im EU-Parlament. Herr Cohn-Bendit, geht Europa gerade kaputt?
„Jetzt werde ich gleich mal sauer“, ruft er mit seinem ganz leichten französischen Akzent. "Wie steht es in den Niederlanden?“ Geert Wilders VVP ist zweitstärkste Kraft, antworte ich. „Wie viel Prozent?“, ruft Cohn-Bendit. Um die 15, schätze ich vorsichtig. „Genau“, sagt er, „wie überall gibt es auch in den Niederlanden acht, fünfzehn oder vielleicht auch zwanzig Prozent Euro-Skeptiker, Rassisten, Antisemiten, Idioten. So ist die Menschheit leider. Und so wird sie immer sein.“
Doch während alle, besonders die Medien, nur auf die lauten Populisten starren, beklagt Cohn-Bendit, würden die Europafreunde nicht mehr wahrgenommen. „Neulich trafen sich in Frankfurt tausende von Leuten unter dem Motto 'Europa neu denken'. Und diskutierten über das Europa der Zukunft. So wie Tausende bei den europaweiten Demonstrationen von „Pulse of Europe“ zusammen kamen. Warum?“ Cohn-Bendit macht eine Kunstpause. „Weil es ihnen wichtig ist. Es gibt also mindestens genau so viele Menschen wie die 20 Prozent Populisten, die mehr Europa wollen. Die müssen jetzt kämpfen für dieses Europa.“ Er ist sich sicher: Die Nationalisten werden keine Mehrheiten bekommen.
Ganz sicher, Herr Cohn-Bendit? „Ja. So sehr kann man sich nicht irren.“ Der 71-Jährige ist zwar 2014 aus „gesundheitlichen Gründen“ nicht mehr zur Wahl angetreten. Aber kein bisschen müde. „Nochmal: Europa ist nicht kaputt. Die EU hat vieles geleistet. Zugegeben: Europa funktioniert nicht gut. Deshalb brauchen wir eine neue Dynamik. Und wenn nur aus Egoismus. Was ist denn eine deutsche Bundeskanzlerin in Washington ohne Europa? Niemand.“
"Aus dem europäischen Rührei werden keine nationalen ganzen Eier mehr"
Wie also dieses große, wichtige Projekt noch retten? Mit besserer Kommunikation, wie es Kommissionpräsident Jean-Claude Junker und Politikwissenschaftlerin Eva Heidbreder es fordern? Oder gar mit einem "Europa der Stämme“, der Rückbesinnung auf eine reine Handelsunion, wie es die rechtspopulistischen Bewegungen wollen?
Ulrike Guérot hat eine überraschende Antwort: „Wir brauchen nicht weniger EU. Wir brauchen ein anderes Europa. Eine Europäische Republik.“ Dazu bräuchte es jedoch einen Neustart. Vor allem Gleichheit vor dem Recht für alle europäischen Bürger und ein rechtlich verankertes European Citizenship. "Ich hoffe auf Macron und Schulz. Sie könnten zusammen ein funktionierendes, demokratisches und soziales Europa bauen.“
Und Cohn-Bendit will: „einen von den Europäern gewählten Präsident. Eine echte europäische Regierung. Mit einer gemeinsamen Armee, einer Außenpolitik, einer Stimme." Eva Heidbreder ist da vorsichtiger, aber auch sie glaubt: „Martin Schulz könnte ein Versäumnis nachholen: Die Formulierung eines inhaltlichen politischen Programms, in seinem Fall der Sozialdemokraten. Also die Aufmerksamkeit weg von der falschen Frage 'EU oder wir', hin zur Frage: Welche Wirtschafts-, Migrations-, Arbeitsmarktpolitik wollen wir? Welche Alternativen gibt es? Darauf warten die Menschen.“
Also einfach wieder mehr in die Pedale steigen? Das mit dem Fahrrad, das sagte übrigens Jacques Delors, von 1985 bis 1995 Präsident der EG-Kommission, als die EU noch EG hieß. Seitdem ist viel passiert. Heute mag das Fahrrad Europa am Boden liegen. Und manche treten noch gegen die Reifen, damit es nie wieder fährt. Doch ein Zurück zu einem Europa der lose verbundenen Nationalstaaten, da sind sich alle einig, ist kaum vorstellbar. „Sie machen aus dem europäischen Rührei keine nationalen ganzen Eier mehr“, sagt Guérot. „Das hat sie von mir“, lacht Daniel Cohn-Bendit, „und es stimmt. Noch nie war Europa so notwendig wie jetzt. Nicht nur angesichts von Trump und Putin. Nicht nur wegen des Klimas. Sondern immer noch und wieder wegen der Mammutaufgabe einer lebenswerten Globalisierung. Das alles können Nationalstaaten alleine gar nicht leisten."
Europa ist für ihn nach wie vor der einzige Weg. Denn was wäre die Alternative? "Die Kosten, die Austritte sowohl für die Union als auch für die Länder haben, werden nie eingerechnet", beklagt Guérot. Rund 40 bis 60 Milliarden, so schätzt man, kostet der Brexit. Nur wenige scheinen zu erkennen, dass zu Fuß gehen auch nicht besser als ein klappriges Fahrrad ist.