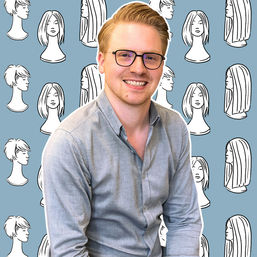- • Startseite
- • Gender
-
•
Haare: Wenn Männer eine Glatze bekommen
Ich liebe Frisuren. Nicht diese modischen, die man an jeder Ecke sieht. Ich meine die echten Trademark-Frisuren: Günter Netzer (bravo!), Donald Trump (zumindest dafür, Chapeau!) oder der Physiker Ernest Moniz (Hochachtung!). Mein Frisuren-Spleen hat einen Grund: Ich selbst habe schon lange keine Haare mehr.
Als Teenager konnte ich mir noch auf dem Höhepunkt meiner Eitelkeit tubenweise Gel in die Haare kneten und die tollsten Kreationen entwerfen. Ich trug den fettsträhnigen Grunge-Look, die gegelte Guttenberg-Welle, die Jim Jarmusch-Sturmhaube. Dann die Uwe Ochsenknecht-Halbglatzen-Matte. Und schließlich: gar nichts.
Zwischen den beiden letzten Phasen lag ein schmerzhafter Prozess, den die meisten Männer früher oder später durchmachen. Ein Prozess des Loslassens, ein Trennungsschmerz vom eigenen Haupthaar - die fünf Phasen der Trauer über das Ende der eigenen Frisur.
Phase 1: Verdrängen
Im Spiegel sieht man sich von vorne, etwas von der Seite, so gut wie gar nicht von oben und überhaupt nicht von hinten. Das ist ein Problem. Denn die Frisur, die man zu tragen glaubt, gibt es gar nicht. Solange man die vorderen Haare noch irgendwie über Stirn und Geheimratsecken klatschen kann, scheint die Welt in Ordnung.
Aber eines Tages sieht man sich auf einem Partyschnappschuss von hinten. Der eingefrorene Moment, in dem einem die Realitätskeule eins über die glänzende Platte zieht, ist zugegebenermaßen ein kleiner Schock. Erstens, weil so ein haariger Trauerkranz um die leuchtende Tonsur alles andere cool aussieht. Zweitens, weil man selbst immer der letzte ist, der kapiert, wie weit das Verfallsdatum bereits überschritten ist. Ich hatte diese Selbstoffenbarung mit 19 Jahren. Auf dem entsprechenden Beweisfoto bücke ich mich gerade nach einem Hula-Hoop-Reifen. Ungünstig in vielerlei Hinsicht.
Warum sagen einem die Leute nicht, dass es an der Zeit ist, die Haarschneide-Maschine anzuwerfen? In meinem Fall wollten mich meine Freunde wahrscheinlich nicht unnötig ärgern. Gerade die Jungs müssen gewusst haben, dass der Bumerang der Zeit, der irgendwann auch ihre eigenen Haare absäbeln wird, schneller zurück kommt, als ihnen lieb ist. Vielleicht gibt es ja bei Männern auch so eine Art Kollektiv-Verdrängung. Nur so kann ich mir all die Halbglatzenunfälle erklären, die man im Alltag ständig sieht. Man erinnere sich nur an die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton. Da steht der junge Prinz in seiner besten Uniform, bereit, das große Königreich ins 21. Jahrhundert zu führen – und keiner traut sich, ihm zu sagen, dass der Verfall des Empires auf seinem Haupt bereits besiegelt ist.
Phase 2: Zorn
Ich habe meine Glatze nie als besonders schlimm empfunden – aber bitteschön alles zu seiner Zeit! Wenn einem mit 19 Jahren im großen Stil die Haare ausfallen, dann ist das doch ein kleiner Stich ins Herz, ein früher Abschied von der Jugend. Die Zeit als Posterboy ist vorbei. Welches Selbstbild man zuvor auch gehabt haben mag – jetzt ist klar, man wird kein Kurt Cobain und schon gar kein Brad Pitt mehr. Man gilt bestenfalls noch als „interessant“. Beim abendlichen Kennenlernen fremder Mädchen ist man neben dem Kumpel mit der Surfermähne immer nur der Sidekick. Erst wenn der über sein Ego stolpert, kommt man zum Zug.
Jammern sollte man, finde ich, trotzdem nicht. Das Blatt wendet sich früh genug. Wer schon früh die Haare verliert, altert langsamer, weil er nicht grau wird, sondern gleich bleibt. Ich behaupte sogar, dass die ganz große Midlife-Crisis (mit plötzlicher Leidenschaft für Harley Davidson-Motorräder und Totenkopf-Bandanas) bei mir ausbleiben wird: Die meisten Leute kennen mich schon jetzt nur mit Glatze oder können sich an meine Haare gar nicht mehr erinnern. Wenn hingegen ein gutaussehender Mann mit Mitte Vierzig seine Haarpracht verliert, muss der Schmerz weitaus tiefer stechen.
Phase 3: Verhandeln
In meinem Abiturjahrgang gab es mehrere Glatzenkandidaten. Jeder hatte so seine eigene Strategie, um mit der drohenden Situation fertig zu werden. Die meisten setzten sich einfach eine Mütze oder ein Cap auf, die Informatiker suchten ihr Heil in Ziegenbart und Pferdeschwanz. Ich persönlich ließ diese Phase mehr oder weniger aus. Mützen sind mir zu warm, von Cappies bekomme ich Kopfschmerzen, und an die Option, irgendwelche Tropfen oder Pillen zu schlucken, habe ich bis heute keinen einzigen Gedanken verschwendet. Das überlasse ich den Herren, die in einem Akt der Verzweiflung ihre letzte jämmerliche Spaghetti-Strähne über der verschwitzten Platte ausbreiten.
Obwohl, ein kleines bisschen enttäuscht bin ich schon, dass nicht einmal die Gummibärchen, die ich seit meiner frühen Kindheit mit Begeisterung verzehre und die ja angeblich gut für den Haarwuchs sein sollen, etwas gebracht haben. Bestenfalls an Stellen, wo kein Mensch Haare braucht, geschweige denn will. Meine anfängliche These, nach der ich nur deshalb keine Haare habe, weil ich evolutionär gesehen schon ein Stückchen weiter bin als andere, musste ich daher leider schon vor Jahren verwerfen.
Als bessere Strategie erschien mir, auszuloten, welcher Typ von Glatzenträger ich in Zukunft sein wollte. Denn Platte ist ja keineswegs immer gleich Platte. Am besten, so dachte ich, freunde ich mich mit dem Gedanken des Kahlschlags an, indem ich die glatzköpfigen Geister berühmter Persönlichkeiten heraufbeschwöre. Ein Glück übrigens, dass ich nie Brillenträger war. Ich musste also nicht fürchten, versehentlich zu dem Typ Glatze zu werden, der mit „pfiffiger“ Designerbrille im Shopping-Fernsehen Pauschalreisen vertickt.
Ich sah mich eher als einen der Männer, auf die die Frauen gerade wegen ihrer Glatze stehen: Typ Jon Malkovich, Vin Diesel, Bruce Willis. Ja, mit diesem Gedanken konnte ich mich ganz gut anfreunden.
Aber am Tag, an dem ich das erste Mal die neu gekaufte Haarschneide-Maschine ansetzte, kam eh alles anders. Das brutale Säbelrasseln der Maschine hatte so gar nichts Glamouröses, und sobald ich den ersten breiten Streifen in den Schädel rasiert hatte, blickte mich aus dem Spiegel eine ziemlich exakte Kopie von Edvard Munchs berühmtem Bild „Der Schrei" an. Aber da war es schon zu spät. Wie gekochte Artischockenblätter fielen die Büschel, und damit der ganze Themenkomplex „Frisur“, für immer von meinem Kopf.
Das eigene Spiegelbild hat in diesem Moment eine ähnliche Wirkung wie das Bild einer Katze, die gerade in die Badewanne gefallen ist. Ein vormals stolzes Raubtier, zusammengeschrumpelt auf ein jämmerliches Etwas. Zum Glück währt dieser Schock nicht lange. Sobald sich die ersten Stoppeln im Gesicht und auf dem Kopf zurückgebildet haben, durchläuft man seltsame Typveränderungen: Aus dem frisch gepellten Ei wird allmählich wieder ein Mann. Und ja, mit ein klein wenig Fantasie sieht man dann sogar aus wie Bruce Willis. Beziehungsweise mit ziemlich viel Fantasie.
Phase 4: Tiefe Trauer
Am Tag, an dem ich mir zum ersten Mal den Kopf rasiert hatte, und somit ohnehin schon äußerst unsicher das Haus verließ, fuhr ich ungünstigerweise auch noch U-Bahn. Ein Ort, den ich normalerweise meide, weil ich meine, dass man sich Depressionen auch züchten kann. Und tatsächlich: Als ich aussteigen wollte, sagte ein kleines Mädchen zu seiner Mutter: „Der Mann mit der Glatze steigt aus.“ Die Mutter antwortete: „Ja, der Mann mit der Glatze steigt aus, aber wir nicht.“
Phase 5: Akzeptanz
Derartige Rückschläge wurden seit jeher durch überwiegend positive Rückmeldungen kompensiert. Ich bekomme als Glatzkopf Komplimente, die ich mit meinen aufwendig gestylten Frisuren nie bekam. Meine geliebte Nachbarin lobt regelmäßig meine hervorragende Schädelform; dann und wann bekomme ich unerwartete Kopfmassagen; und wenn mich seit damals Freundinnen verlassen haben, dann bestimmt nicht für Männer mit einer tollen Frisur (glaube ich).
Ich bilde mir sogar ein, einen zusätzlichen Wiedererkennungswert zu besitzen. Flüchtige Bekanntschaften erinnern sich fast immer an mich, Freunde orientieren sich in überfüllten Bars und Clubs immer an der einen weißen Boje zwischen all den haarigen Köpfen. Ist das nicht toll?
Schwierig ist in dieser Hinsicht nur, dass man als Glatzkopf ständig mit anderen Glatzköpfen verwechselt wird. Dann klapsen einem wildfremde Menschen auf die Schulter, tatschen einem auf den Kopf oder winken dämlich von der anderen Straßenseite. Mich haben sogar schon Matthias Schweighöfer und Cosma Shiva Hagen sehr höflich gegrüßt. Mit wem sie mich verwechselten, weiß ich bis heute nicht, aber ich fühlte mich geschmeichelt. Und übrigens, weil sowohl Schweighöfer als auch Hagen tolle Haare haben: Schöne Frisuren anderer Leute kann ich noch immer sehr bewundern, ganz ohne Neid.
Naja, fast.
Dieser Text wurde am 7. April 2013 veröffentlicht und am 26. November 2020 noch einmal aktualisiert.