- • Startseite
- • Gutes Leben
-
•
Martin Schröder über sein Buch „Warum es uns noch nie so gut ging“
Schlechte Nachrichten gibt es immer. Terroranschläge, Hungerkatastrophen, Bürgerkriege, drohende Altersarmut, eine gefährdete Mittelschicht, offener Rechtsradikalismus – das alles vermittelt den Eindruck, mit der Welt geht es bergab. Stimmt aber nicht. Es geht uns so gut wie nie zuvor, sagt der Soziologe Martin Schröder. Und sagen die Statistiken, mit denen er in seinem Buch „Warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden“ argumentiert.
jetzt: Ich bin eigentlich kein pessimistischer Mensch. Aber manchmal bekomme ich das Gefühl, dass es der Welt immer schlechter geht. Sie sagen, dafür gebe es eigentlich keinen Grund. Warum?
Martin Schröder: Da muss man unterscheiden. Natürlich gibt es bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel dem Klimawandel, Gründe, die Entwicklungen negativ zu sehen. Ich sage ja nicht: Lasst uns die Welt nur noch positiv betrachten. Doch bei vielen Themen wird ausgelassen, um wie viel sich da etwas gebessert hat. Für mein Buch habe ich über 50 verschiedene Indikatoren wie Kriegsopfer, weltweite Armut oder die Ungleichbehandlung der Geschlechter untersucht. Und bei 90 Prozent der Indikatoren sind die Dinge besser geworden.
Fehlt es uns an Wertschätzung oder was ist das Problem?
Zum einen tendiert der Mensch dazu, die Vergangenheit viel rosiger zu betrachten als sie tatsächlich war. Eigentlich ist das verständlich – wer klebt sich schon unschöne Erinnerungen ins Fotoalbum? Zum anderen sind wir viel sensibler geworden, was zum Beispiel Kriege und Gewalt angeht. Denn die sind nicht mehr so alltäglich wie früher. An einem durchschnittlichen Tag während des Zweiten Weltkrieges sind 30.000 Menschen gestorben. Heute sind wir geschockt, wenn bei einem Terroranschlag in Berlin 14 Menschen sterben.
„Es ergibt Sinn, auf negative Dinge intensiver zu reagieren als auf positive“
Was zweifellos auch schrecklich ist.
Natürlich. Sensibilität an sich ist ja nichts Schlechtes. Es ist eigentlich gut, wenn uns der Tod von 14 Menschen schockiert. Denn es heißt, dass unsere Ansprüche gestiegen sind. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der es normal ist, dass jeden Tag Tausende Menschen in einem Krieg oder an einer Epidemie sterben. Doch wird leider der Fehler begangen, unsere gewachsenen Ansprüche an eine friedliche Welt damit zu verwechseln, dass die Welt schlechter wird, weil sie unseren Ansprüchen nicht mehr genügt. Sensibilität kann ein Vorteil sein und dazu führen, dass wir uns Problemen noch tiefer widmen. Doch wird sie selbst zum Problem, wenn wir dadurch nur noch alles schlecht sehen. Denn dieses Gefühl hemmt, anstatt zu motivieren.
Warum reagieren wir heftiger auf schlechte Nachrichten als auf gute?
Es ergibt Sinn, auf negative Dinge intensiver zu reagieren als auf positive. Denn an den positiven muss man bekanntlich nichts ändern. In früheren Zeiten war das überlebenswichtig, wenn es hieß: „Neben dir lauert ein Säbelzahntiger.“ Oder: „Vor deiner Burg steht eine Armee.“ Heute ist unsere Reaktion auf schlechte Nachrichten vielleicht nicht mehr überlebenswichtig, aber sie lassen uns immer noch aufschrecken. Es werden viele Emotionen angesprochen, auch, wenn die Gründe nicht immer rational sind. Außerdem kann der Mensch sich Wahrscheinlichkeiten sehr schlecht vorstellen. Deswegen fahren wir nach einem Terroranschlag mit einem mulmigen Gefühl U-Bahn, obwohl wir wissen müssten, dass die Chance sehr gering ist, selbst zum Opfer zu werden. Das liegt auch an der Berichterstattung in den Medien: Wir erfahren etwas über die 0,1 Prozent der Welt, wo gerade etwas katastrophal schief läuft. Aber über die restlichen 99,9 Prozent Normalität erfahren wir nichts.
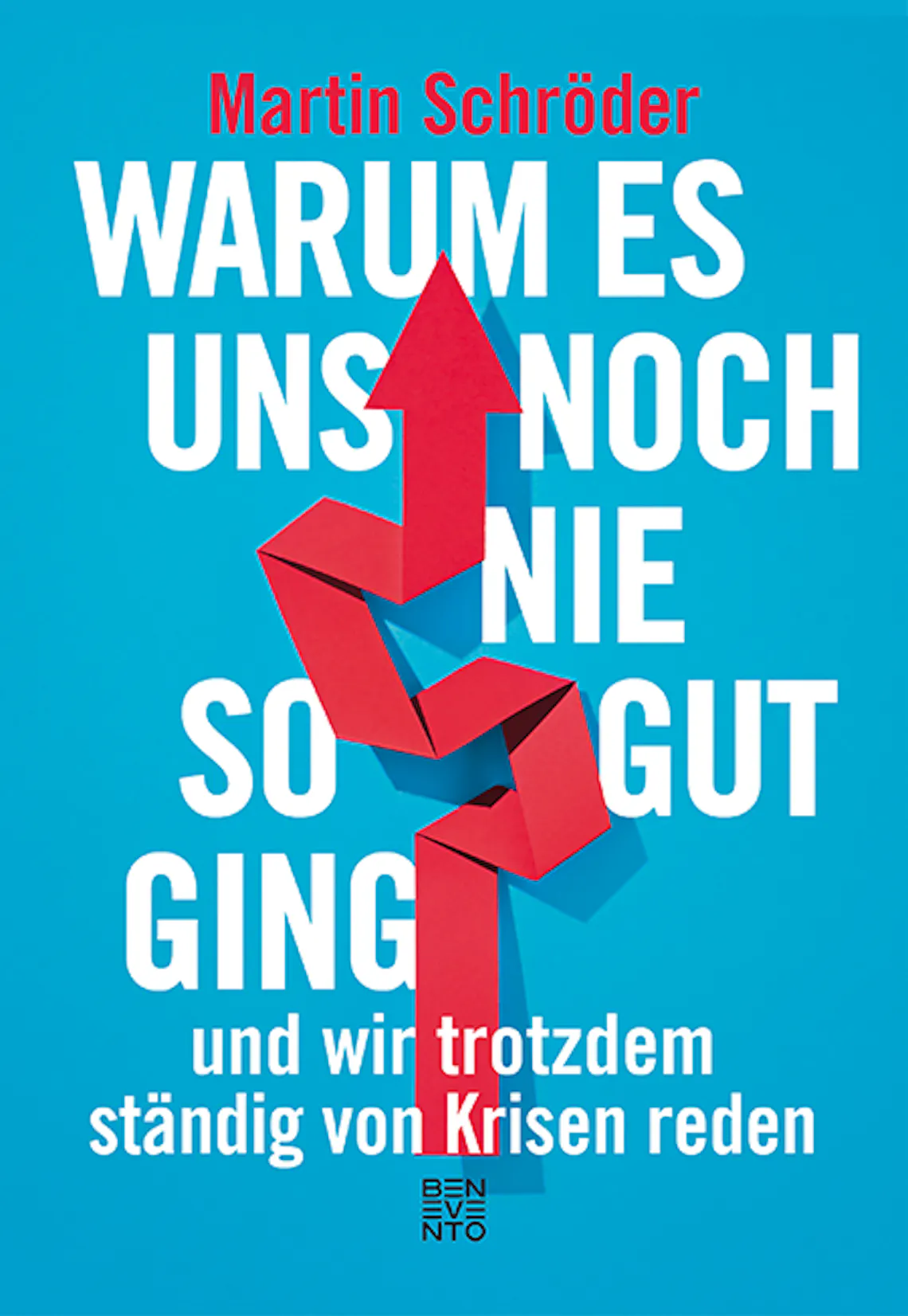
Viele Journalisten sehen es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, über Missstände zu berichten.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich will auch, dass Journalisten kritisch berichten. Doch würde ich mir wünschen, dass Nachrichten mehr in einen Gesamtkontext eingeordnet werden. Wenn wir von einem Flugzeugabsturz erfahren, wäre es wichtig zu wissen, dass das die Ausnahme ist und Fliegen immer sicherer geworden ist. Auf diese Weise können sich Menschen eher eine Meinung aufgrund von Fakten als auf der Basis von Gefühlen machen.
Dennoch gibt es Probleme, die dringend angegangen werden sollten. Zum Beispiel die weltweite absolute Armut, also die Armut von Menschen, die weniger als 1,90 Dollar am Tag zur Verfügung haben. Besteht mit Ihrer Herangehensweise nicht auch die Gefahr, die Dinge zu locker zu sehen?
Stimmt, da muss man aufpassen. Denn es geht nicht darum, nur noch alles schönzureden. Das wäre in der Tat positiver Fatalismus. Wichtig ist es, sich mehr Informationen anzueignen und sich möglichst alle Seiten eines Sachverhaltes anzusehen. Dazu gehört auch, dass sich viele Dinge deutlich verbessert haben. Die weltweite absolute Armut liegt heute bei zehn Prozent. Im Jahr 2000 waren es knapp 30 Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt nicht, dass 700 Millionen Menschen nicht immer noch zu viele sind. Doch zeigt es, dass wir in unserer Strategie, Armut zu bekämpfen, nicht ganz falsch liegen. Daraus kann man lernen und sich motivieren lassen. Denn warum sollte ich mich für eine hoffnungslose Welt überhaupt noch engagieren?
„Es geht nicht darum, nur noch alles schönzureden. Das wäre positiver Fatalismus“
Was hat Sie bei Ihren Nachforschungen am meisten erstaunt?
Das waren vor allem solche Zahlen wie der Rückgang der weltweiten Kriegsopfer: Da sind die Zahlen seit dem Jahr 1950 um 90 Prozent zurückgegangen. Besonders interessant fand ich auch die allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen. Die liegt bei den Deutschen bei durchschnittlich 7,3 von 10 Punkten – also eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Doch wenn man die Menschen nicht nach sich selbst, sondern nach den anderen fragt, dann schätzen sie die Lage deutlich schlechter ein, und diese Einschätzungen werden noch negativer, wenn man sie nach dem Leben außerhalb Deutschlands und Europa befragt.
Auch Populisten prophezeien hierzulande eine negative Zukunft und sammeln damit Anhänger. Was kann man denen entgegensetzen?
Zunächst mal muss man sagen, dass diese an einen Trend anknüpfen, der nicht so einfach wegzudiskutieren ist. Vor den Siebzigerjahren hat sich der Lebensstandard der Deutschen in 30 Jahren mehr als verdoppelt. Das passiert heute nicht mehr. Manche Menschen, die heute 50 sind, haben aber noch genau diese Entwicklung von ihren Eltern mitbekommen und fühlen sich nun um etwas betrogen oder abgehängt. Tatsächlich bekomme ich Hass-Mails von Menschen, für die es anscheinend das Allerschlimmste ist, wenn man sagt: „Es ist gar nicht alles schlechter als früher, sondern vieles ist besser.“ Ich kann mir das zwar nicht vollständig erklären, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass unsere Diskussionskultur zu emotional geworden ist – in den Medien wie auch in der Politik. Es wird zu viel über Meinungen geredet und zu wenig über Fakten. Dieses Problem sehe ich allerdings in allen politischen Lagern.


