- • Startseite
- • Religion
-
•
„Weil ich hier leben will“ - Buch über junges jüdisches Leben in Deutschland
Juden in Deutschland – bei diesem Thema denken viele Deutsche an genau drei Dinge: Holocaust, Antisemitismus, israelische Politik. Vergessen wird dabei gern, dass sich das jüdische Leben in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt hat, dass es mittlerweile eine ganze Generation junger Jüdinnen und Juden gibt, die andere Geschichten erzählen, sich vielfältiger einbringen wollen und auch einen anderen Background haben, als es die deutsche Mehrheitsgesellschaft erwartet – neben der natürlich dennoch wichtigen Erinnerung an Verfolgung und aktuellen Antisemitismus.
Jonas Fegert, 28, ehemaliger Stipendiant und Referent des jüdischen Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks, ist Mit-Herausgeber des Buches „Weil ich hier leben will“. Dort meldet sich diese junge Generation in essayistischen Beiträgen zu Wort, die Autoren und Autorinnen sind jeweils Stipendiaten des Studienwerks. Wir haben mit Jonas über die Vielfältigkeit der Perspektiven jüdischen Lebens, festgefahrene Vorstellungen und neuen Antisemitismus gesprochen. „Weil ich hier leben will“ ist am Montag im Herder Verlag erschienen.
jetzt: Jonas, in eurem Buch beschreibt eine Autorin ihre Unruhe und Bewunderung für ihre Tochter, die einem Fremden in der Trambahn erzählt, dass sie in einen jüdischen Kindergarten geht. Wie „normal“ ist jüdisches Leben in Deutschland heutzutage?
Jonas Fegert: Natürlich gibt es eine Normalität jüdischen Lebens in Deutschland. Andererseits sind Jüdinnen und Juden in dem Land eine Minderheit, weshalb sie sich in ihren Bedürfnissen von denen der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Hier gibt es übrigens Übereinstimmungen mit muslimischen Gemeinschaften.
Bei unserer Arbeit beim Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk geht es auch immer darum, in Allianzen mit anderen Minderheiten auf diese Bedürfnisse aufmerksam zu machen.
Findest du es begrüßenswert, wenn Politiker von einer christlich-jüdischen Prägung in Deutschland sprechen?
Nein, das halte ich für eine Verdrehung der Geschichte. Ich sehe das historisch und kulturell einfach nicht. Natürlich hat sich das Christentum aus dem Judentum entwickelt, keine Frage. Aber wenn ich „christlich-jüdisches Abendland“ höre, denke ich nicht an friedliche Koexistenz, was der Begriff impliziert, sondern an eine lange Geschichte von Ausgrenzung und Verfolgung. Heute dieses Verhältnis zu konstruieren, um es als politischen Kampfbegriff zu nutzen und damit wiederum andere aus der Gesellschaft auszuschließen, ist nicht akzeptabel. Genau dafür sollten Jüdinnen und Juden nicht zur Verfügung stehen.
Noch ein Schlagwort: Neuer Antisemitismus.
Das „neu“ würde ich erst einmal in Frage stellen. Es gibt große Kontinuitäten von Antisemitismus in Deutschland. Er ist natürlich nicht mit dem Ende des Nationalsozialismus verschwunden. Es kam in der bundesrepublikanischen Geschichte durchgehend zu antisemitischen Vorfällen, seien es Attacken auf Menschen und Einrichtungen oder Aussagen von Politikern der unterschiedlichsten Parteien. Ein Beispiel ist Martin Hohmann, der wegen seiner antisemitischen Bundestagsrede aus der CDU ausgeschlossen wurde und heute erneut für die AfD im Bundestag sitzt.
Siehst du eine Verschlimmerung in den vergangenen Jahren?
Ich glaube schon, dass sich viele Jüdinnen und Juden aktuell größere Sorgen über die Situation in diesem Land machen. Zwar auch wegen antisemitischem Gedankengut in bestimmten Migrantengruppen, vor allem aber bezüglich des Erstarkens der Neuen Rechten. Wenn sich rassistische Stereotype und nationalistisches Denken in einer Gesellschaft ausbreiten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese auch Jüdinnen und Juden betreffen. Und das passiert ja auch: Die Umdeutung der Geschichte durch die AfD, das Kleinreden der Jahre 1933 bis 1945, die Verharmlosung der Wehrmacht: Das sind die Dinge, die unserer Gemeinschaft gerade wirklich zu schaffen machen.
Glaubst du, dass es Menschen in der jüdischen Community gibt, die für die Islamophobie der AfD empfänglich sind?
Da will ich nichts schönreden. Antimuslimische Ressentiments sind – genau wie Antisemitismus – ein gesamtgesellschaftliches Problem, es gibt sie also auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Die meisten Jüdinnen und Juden haben ja selbst eine Migrationsgeschichte. Ich glaube, dass in einigen Fällen die Überidentifikation mit Deutschland dazu geführt hat, dass sie einen deutschen Antisemitismus ausblenden und das Sprechen von einem „neuen Antisemitismus“ übernehmen. Repräsentativ für die jüdische Gemeinschaft sind die paar Leute bei „Juden in der AfD“ aber auf keinen Fall. Von dieser Gruppe haben sich ja auch die deutschen jüdischen Organisationen in einer selten deutlichen Form distanziert.
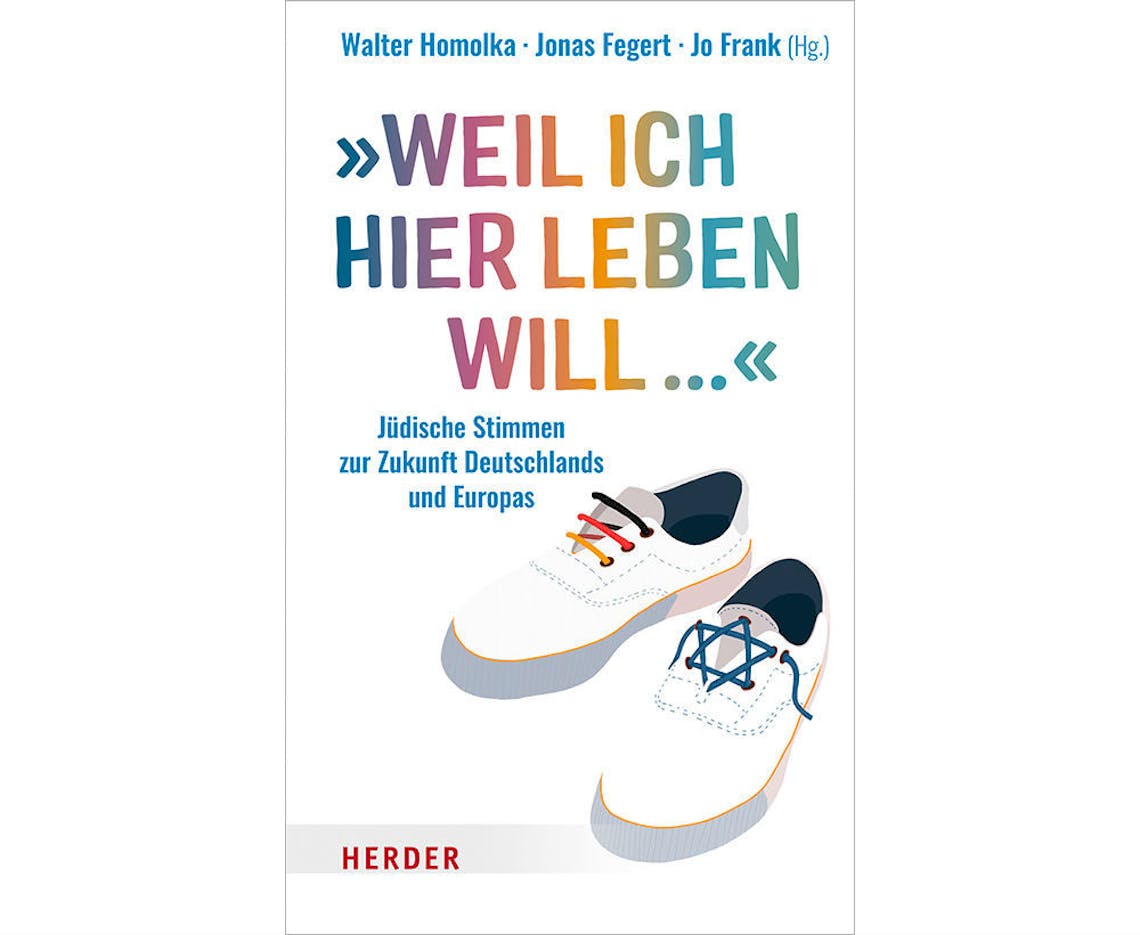
In der Einführung zu „Weil ich hier leben will“ heißt es, dass es erstmals eine junge jüdische Generation gibt, die sich zu Wort meldet und zu Debatten in Deutschland einbringen will. Was war vorher anders?
Der Unterschied liegt in der Zusammensetzung der Gemeinschaft, die sich im Vergleich zur vorherigen Generation verändert hat. Bis 1990 waren die meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland Überlebende des Holocaust oder ihre Nachfahren. Das Nachkriegsdeutschland hatte den Nationalsozialismus nicht vollständig überwunden, was absolut spürbar war. Es gab das Sprichwort von den „gepackten Koffern“, auf denen man saß. Das Land, von dem der Holocaust ausging und organisiert wurde, als seine Heimat zu begreifen, war verständlicherweise ein Tabu. Das hat sich in den 90ern geändert, als Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland kamen. Sie haben sich hier ein besseres Leben erhofft, einen Ort, an dem sie jüdisch leben können. Das war ein Wendepunkt. Seit den Nullerjahren kamen viele junge Israelis und Jüdinnen und Juden aus anderen Teilen der Welt dazu, vor allem Berlin ist hier ein Anziehungspunkt. Dadurch ist eine große Vielfalt jüdischen Lebens entstanden – und klar, diese Menschen wollen sich einbringen und äußern. Unser Buch ist ein Ergebnis dessen.
Das Interesse der deutschen Öffentlichkeit beschränkt sich im Bezug auf Juden oft nur auf die Themen Shoa, Antisemitismus und Israel. Siehst du da auch einen Wandel?
Es ist weiterhin leider so, dass jüdische Stimmen oft nur zu bestimmten Anlässen zu Wort kommen, zum Beispiel zum Gedenken am 9. November. Innerhalb der deutschen Gesellschaft gibt es da auch ein paar schräge Vorstellungen: So haben ja bei weitem nicht alle Jüdinnen und Juden das gleiche Erinnerungsnarrativ, was den Zweiten Weltkrieg betrifft. Die aus der Sowjetunion stammenden Jüdinnen und Juden haben zum Beispiel oftmals eine andere Wahrnehmung. Nämlich die, dass ihre Vorfahren im „Großen Vaterländischen Krieg“ den Faschismus besiegt hätten – ein Gewinnernarrativ also. Was die Mehrheitsgesellschaft über Juden denkt, ist oft negativ konnotiert. Wir wollen zeigen, dass die Vielfalt jüdischen Lebens mit dieser Erwartungshaltung nichts zu tun hat.
Viele konstruieren sich ihren Antisemitismus aus einer Gleichsetzung von Judentum und israelischer Politik zusammen. Wie sehr nervt es, sich als Jude ständig für israelische Politik rechtfertigen zu müssen?
Es nervt ziemlich. Es belastet. Das Verantwortlichmachen von Jüdinnen und Juden für die Politik des Staates Israel ist eine antisemitische Verdrehung. Meine letzten zwei Schuljahre war ich auf einer jüdischen Oberschule. Während des Gaza-Konflikts haben Leute vor dem Eingang gegen Israel protestiert – als ob die Schule etwas damit zu tun hätte. Unser Buch soll auch zeigen: Klar, Israel spielt für viele durchaus eine Rolle, aber wir würden gerne über die deutsche und europäische Gesellschaft reden und diskutieren.
Max Czollek, einer eurer Autoren, hat gerade großen Erfolg mit seinem Buch „Desintegriert euch!“. Zentraler Gedanke ist, sehr verkürzt: Die deutsche Gesellschaft braucht und und konstruiert sich ein bestimmtes Bild von Juden, um sich ihrer eigenen Läuterung, ihrem „Lernen aus der Geschichte“ vergewissern zu können. Wie entkommt man dieser Zwangsumarmung?
Max' Beitrag in unserem Buch, in dem er diese These ausführt, ist ja einer von vielen und es gibt auch einige, die das anders sehen. Aber die Frage ist: Wann ist jüdisches Leben in Deutschland ein Thema? Ein Gespräch über jüdisches Leben aus einem positiven Anlass, wie zum Beispiel hier gerade aufgrund unserer Buchveröffentlichung, ist verdammt selten. Was kann man tun? Viele der jüngeren Generation versuchen von sich aus, die Dinge anders zu handhaben, sich eben einfach selbst einzubringen und sich zu äußern. Im Fall von Max mit Büchern oder Veranstaltungsreihen am Maxim Gorki Theater. Es geht darum, andere Perspektiven zu eröffnen, die sich dieser Zwangsumarmung entziehen.
Viele der Autoren vervollständigen in ihrem Beitrag den Titelsatz „Weil ich hier leben will“. Wie würdest du den Satz zu Ende bringen?
Weil ich hier leben will, möchte ich mich in diese Gesellschaft einbringen und dafür sorgen, dass sie ihre Vielfalt anerkennt und offener wird. Das würde jüdisches Leben lebenswerter machen. Ach, eigentlich das Leben aller.


