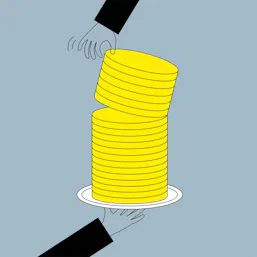- • Startseite
- • Studium
-
•
Als Arbeiterkind an der Uni: Wie es ist, als Studentin nicht aus einer Akademikerfamilie zu kommen
Noch immer sind Arbeiterkinder an der Uni deutlich unterrepräsentiert. Während 71 Prozent der Akademikersprösslinge es bis an die Uni schaffen, sind es bei Arbeiterkindern nur 24 Prozent. Ich selbst darf mich zu dieser vergleichsweise seltenen Spezies zählen: Mein Vater ist Elektriker, meine Mutter Hausfrau und arbeitet auf Minijobbasis als Reinigungskraft. Direkt nach meinem Realschulabschluss habe ich mir nicht mal das Abitur, geschweige denn ein Studium, zugetraut und habe erstmal eine Ausbildung zur Industriemechanikerin absolviert. Eine Berufsperspektive, die mir aus meinem familiären Umfeld vertraut war. Erst nach der Lehre habe ich mein Abitur nachgeholt und mich dann doch für ein Studium entschieden. Das solide Gehalt tauschte ich gegen den prekären Status einer Studentin. Meine Eltern waren meinen Plänen gegenüber recht aufgeschlossen (und vielleicht auch ein wenig stolz), auch wenn sie natürlich nicht ganz verstanden, was ich mit dem Studium im Einzelnen vorhatte. Wie sich die Uni für mich als Arbeiterkind angefühlt hat:
Ich musste meinem gewohnten Umfeld wiederholt den Sinn meines Studiums erklären
Was sind Tutorien? Wie teile ich mir meinen Stundenplan ein? Und wie recherchiere ich am besten in Forschungsliteratur in der Bib? Auf all das hatte ich keine Antworten. Verunsichert fragte ich eine Kommilitonin, ob ich mir wirklich jede Literaturempfehlung der Professoren anschaffen müsse. Anders als in der Schule durfte ich mir nun plötzlich eigenständig Lehrveranstaltungen nach Belieben aussuchen und bestimmte selbst, wann ich welche Prüfung ablegen wollte. Einerseits eine angenehme Freiheit. Andererseits fehlte mir nun eine externe „Kontrollinstanz“, die sicherstellte, dass ich mein Studium auch wirklich gewissenhaft absolvierte, wie meine Lehrer es an der Schule getan hatten.
So hatte ich die Möglichkeit, eine schwierige Prüfung so lange vor mir herzuschieben, bis das Bafög-Amt irgendwann den Geldhahn zugedreht hätte. Meine Eltern konnte ich in diesen Dingen nicht um Rat fragen: Sie hätten mir eh nicht helfen können und haben bis heute nur eine ungefähre Vorstellung davon, was ich an der Uni eigentlich gemacht habe.
Alte Freunde aus der Schule, allesamt in handwerklichen und kaufmännischen Ausbildungsberufen tätig, konnten nicht so ganz verstehen, was ich da jetzt eigentlich studierte. Die wohl häufigsten Fragen lauteten: „Aber was willst Du denn damit machen? Kann man damit Geld verdienen?“ Klar, unter der Fächerkombination Deutsche Literatur und Gender Studies kann man sich schwerlich einen konkreten Job vorstellen. Auch wenn ich erklärte, dass man damit in Verlagen, Kultureinrichtungen oder sogar Unternehmensberatungen arbeiten kann, wurde ich meist nicht ernst genommen. Dass ich insgeheim Journalistin bzw. Schriftstellerin werden wollte, erzählte ich meist erst gar nicht. Genauso gut hätte ich behaupten können, Hollywood-Schauspielerin werden zu wollen, so absurd mutete ihnen mein Berufswunsch an. Ihrer Meinung nach hätte ich besser Industriemechanikerin bleiben sollen. Zumal dort der Verdienst mit rund 1400 Euro netto solides Mittelmaß hatte. Für mein vertrautes Umfeld war mein Studium somit ein „Abstieg“ und wenig sinnvoll.
Ein Nebenjob war keine Option sondern Pflicht
Viele meiner Kommilitonen konnten sich aussuchen, ob sie arbeiten gehen oder sich lieber ganz dem Studium widmen. Für mich stellte sich diese Frage gar nicht: Natürlich habe ich einen 400-Euro-Job in der Anzeigenabteilung einer Zeitung angenommen, auch wenn ich dadurch weniger Zeit für die Uni hatte. Schließlich bezahlten sich die Miete und weitere laufende Kosten nicht vom Bafög alleine. Manche meiner Kommilitonen haben 800 Euro monatlich von ihren Eltern überwiesen bekommen. Ich bekam das letzte Mal Geld von meinen Eltern zum bestandenen Abitur. 100 Euro war mein höherer Schulabschluss als erste in der Familie ihnen wert. Ich habe mich damals sehr darüber gefreut, weil ich wusste, dass das für meine Eltern viel Geld ist. Für mich im Übrigen auch: Ich habe es in einen Laptop für die Uni investiert.
Da ich auf das Bafög angewiesen war, musste ich mein Studium möglichst in der Regelstudienzeit von sechs Semestern absolvieren. Der Nebenjob durfte also nicht die Uni gefährden, da man mir sonst möglicherweise den monatlichen Bafög-Satz gestrichen hätte. Wären Job oder Bafög weggebrochen, hätte niemand mich dauerhaft finanziell auffangen können, was das Ende meines Studiums bedeutet hätte. Also habe ich schon zu Studienbeginn einen Plan erstellt, wann ich welches Modul absolvieren muss. Diesen Zeitplan habe ich einigermaßen diszipliniert versucht einzuhalten. Nachträglich noch eine Kurswahl zu revidieren, wurde so allerdings unmöglich. Also zog ich so manch einen ungeliebten Kurs zähneknirschend durch.
Ein Praktikum? Zu kostspielig
Sicher hätte ein freiwilliges Praktikum mir den Berufseinstieg erleichtert. Die kleinen Verlage und Theater, bei denen ich mich bewarb, hatten allerdings kein Geld, um mich zu bezahlen. Also plante ich, nur für einen Monat ein unbezahltes Praktikum zu absolvieren. Dafür habe ich in meinem Nebenjob fleißig Überstunden angesammelt und Hausarbeiten verschoben. Was mir damals noch nicht klar war: Praktika werden meistens nur in einem Zeitrahmen von drei bis sechs Monaten vergeben. Das war für mich einfach nicht realisierbar. Obendrein hätte ich mit einem monatelangen Praktikum auch wieder meine Regelstudienzeit gefährden können. Somit endete dieser geplante Ausflug ins Berufsleben dann leider damit, dass ich gar kein Praktikum absolviert habe.
Finanzielle Schwierigkeiten, die Angst vor Bafög-Schulden oder die Regelstudienzeit nicht einhalten zu können – das alles konnten viele meiner Kommilitonen nicht ganz nachvollziehen. Sie selbst kamen aus wohlsituierten Akademikerhaushalten und mussten sich um derlei Probleme wenig bis keine Gedanken machen. Als ich einmal durch eine mündliche Prüfung fiel, brachte das meinen Zeitplan gehörig durcheinander. Für mich ein echtes Problem, für meine Kommilitonen gar nicht so schlimm: „Dann studierst du eben ein paar Semester länger“, war eine immer wiederkehrende Aussage, die mir leider nicht weitergeholfen hat. Während die Eltern dieser Kommilitonen mühelos für ihren Lebensunterhalt hätten aufkommen können, konnte ich meine höchstens mal nach 100 Euro fragen.
Ein „Gap-Year“ war unerreichbar
Kurz vor dem Abschluss traf ich mich abends mit Kommilitonen in einer Kneipe. Sie diskutierten darüber, wie sie ihr persönliches „Gap Year“ gestalten wollten, also eine meist einjährige Auszeit zwischen Bachelor und Master, in dem sie verschiedene Länder zu bereisen gedachten. Dass die Finanzierung von den Eltern übernommen werden sollte, stand dabei außer Frage. Ich sank derweil immer tiefer in das Hipster-Bar-Sofakissen und beteiligte mich nicht an der Unterhaltung. Ich wechselte schnell das Thema, um nicht verschämt erklären zu müssen, dass so etwas für mich einfach finanziell völlig utopisch ist. Nicht mal ein Auslandssemester konnte ich mir leisten. Mein Freund und ich teilten uns eine Wohnung, er war auf meinen Mietanteil angewiesen. Der Untervermietung meiner Hälfte des Bettes hätte er wohl nur ungern zugestimmt. Die finanziellen Verpflichtungen im Ausland und zu Hause gleichzeitig wären für mich nicht tragbar gewesen.
Als ich nach Hause in mein kleines Heimatdorf fuhr, fühlte ich mich plötzlich sehr fremd. Bei meinen Eltern und Geschwistern eckte ich nun häufig an, wenn ich sie für fragwürdige politische Stammtischparolen kritisierte. Im Gegenzug dazu verlangten sie, dass ich aufhören sollte, so „hochgestochen daherzureden“. Sie kritisierten meinen angeblich übermäßig angestiegenen Gebrauch von Fremdwörtern und den Versuch über moralphilosophische Thesen zu diskutieren, mit denen sie nichts anfangen konnten. Obwohl man mir daheim mein „intellektuelles Gelaber“ vorwarf, fühlte ich mich paradoxerweise an der Uni oft ebenso fremd. Ich war von meinen Kommilitonen eingeschüchtert, die auf wissenschaftlichem Niveau über Hegel und Kafka diskutierten. Ich hielt mich in diesen Disputen häufig bedeckt, weil ich glaubte, dass jeder an meiner einfachen Aussprache sofort meine grobschlächtige Herkunft erkennen müsste. Wirklich dazugehörig fühlte ich mich nun weder in meinem gewohnten Umfeld noch an der Uni.
Möglichst schnell in den Beruf
Nach meinem Bachelorabschluss wollte ich endlich mehr Geld verdienen, auch für ein mögliches späteres Masterstudium, weshalb ich direkt in den Beruf eingestiegen bin. Als Akademikerkind mit weniger finanziellem Druck hätte ich vermutlich den bequemeren Weg gewählt und den Master direkt angeschlossen. Aber die Berufserfahrung wird sich hoffentlich später auszahlen, auch wenn ich die freie Zeiteinteilung und die hauptberufliche Beschäftigung mit schöngeistiger Literatur und feministischer Theorie schmerzlich vermisse. Der Weg zurück in die starren Strukturen eines Jobs fühlte sich ziemlich beengend an. Wo ich doch gerade erst die Freiheit des Denkens und Lernens kennengelernt hatte.
So finanziell prekär die erste Hälfte meiner Studienzeit auch gewesen sein mag, so wenig möchte ich diese Zeit missen. Ein Lebensabschnitt, in dem ich zwar wenig Geld und dadurch auch viele Probleme hatte, aber auch viele neue Erfahrungen gemacht habe. In keinem Abschnitt meines Lebens konnte ich mich näher mit Dingen beschäftigen, die mich gerade am meisten interessieren. Besonders die gesellschaftskritischen Inhalte meines Studiums haben meinen persönlichen Horizont maßgeblich erweitert. Das intensive Einarbeiten in ein kleines Forschungsfeld und stundenlanges Stöbern in der Bibliothek haben mir doch wider Erwarten am meisten Freude gemacht. Nachdem ich mein Abitur neben dem Job an der Abendschule nachgeholt hatte, war ich mir meines Privilegs, überhaupt studieren zu dürfen, immer bewusst. So habe ich meine Studienzeit und die Freiheiten, die diese mit sich brachte, wohl intensiver erlebt und genutzt als viele meiner Kommilitonen. Obwohl ich den Master von Berufswegen wohl nicht zwingend bräuchte, freue mich jetzt schon auf meine Rückkehr an die Uni.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Text wurde zum ersten Mal am 18. Mai 2017 veröffentlicht und am 22. Juli 2020 noch einmal aktualisiert.