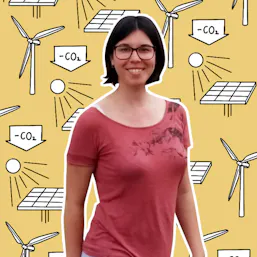- • Startseite
- • jetzt-freiheit
-
•
Wie sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit von Forschenden auswirkt
„Es fehlt mir einfach, irgendwo hinzufahren, ein Loch zu graben und dort etwas unfassbar Altes herauszuholen, das dennoch neu für uns ist“, sagt Mette Bangsborg Thuesen am Telefon und seufzt. Die dänische Archäologin hat genau drei Jahre Zeit, um an dem Thema ihrer Doktorarbeit zu forschen: sassanidische Keramik. Man muss noch nie von den Sassaniden gehört haben, um zu verstehen, was ihr eine Ausgrabung für ihre Doktorarbeit bedeutet hätte – so leidenschaftlich erzählt sie von ihrem Forschungsschwerpunkt. Die Corona-Pandemie ließ diesen Traum zerplatzen.
Internationale Reisen sind für viele Forschende unabdingbar. Für die Archäologin, die in Iran Keramik untersucht. Für die Biologin, die in Südfrankreich Schmetterlinge fängt. Und den Wirtschaftswissenschaftler, der in China mit Unternehmer*innen spricht. Laut einer Studie des DAAD wurden 2017 etwa 14 700 Aufenthalte deutscher Gastwissenschaftler*innen im Ausland gefördert. Forscher*innen eines Promotionsprogramms, wie Mette Bangsborg Thuesen es absolviert, haben in der Regel nur drei Jahre Zeit für ihre Doktorarbeit. Was passiert mit den Forschungsprojekten, die genau in die Corona-Krise fallen? Wie können die betroffenen Wissenschaftler*innen frei forschen, neugierig sein, Wissen schaffen, wenn sie nicht reisen dürfen?
„Nach einer Woche vor Ort rief mein Professor an und sagte, ich müsse so schnell wie möglich zurück“
Durch die Reiseeinschränkungen war für die Archäologin Mette Thuesen ihre Forschungsmethode mit einem Mal hinfällig. Im Februar 2020, als sich das Corona-Virus immer weiter ausbreitete, war Mette Thuesen in Iran, um dort Keramik des Sassanidenreichs, einer entscheidenden Epoche der iranischen Kultur, zu untersuchen. „Ich wollte in unterschiedlichen Ausgrabungsstätten Keramiktraditionen vergleichen und dadurch auf die Nutzung der Gefäße, wie zum Beispiel Essenszubereitung, schließen. Aber nach einer Woche vor Ort rief mein Professor an und sagte, ich müsse so schnell wie möglich zurück.“ Ohne Ergebnisse und Aussicht auf eine Folge-Expedition kam die 27-Jährige an die Freie Universität in Berlin zurück. Ihr Forschungsstipendium reichte genau für drei Jahre und das erste war bereits fast vorüber. Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihr Forschungsvorhaben zu verändern. Also untersuchte sie schließlich sassanidische Keramik aus bestehenden europäischen Sammlungen. Aber es fühlte sich falsch an. „Ich hatte mir das Thema ausgesucht, weil es kaum Aussgrabungsgegenstände aus dieser Zeit gibt. Ich wollte neue finden. Es ist wie ein schwarzes Loch in unserem Geschichtsverständnis.“
Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert auch die Freiheit der Wissenschaft in Deutschland, doch die Forschung wurde durch die Reisebeschränkungen zum Teil stark eingeengt. „Anstatt zu fragen, was gerade wichtig oder interessant zu erforschen ist, frage ich mich jeden Tag: Was ist möglich?“, sagt Mette Thuesen. Sie ist Teil eines Kollegs von Doktorand*innen, die an den Kulturen und Sprachen der Seidenstraße forschen. Viele der Forscher*innen teilen die Erfahrung, durch die Pandemie ihre Funde nicht mehr vor Ort untersuchen und einordnen zu können. Laut dem Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 sind von fehlenden Forschungsreisen besonders die Fächer Archäologie, Meeresbiologie, Philologie und Teile der Kultur- und Geschichtswissenschaften betroffen.
Anaïs Degut, Biologin an der Universität Greifswald, war ebenfalls bereits mitten in ihrer Doktorarbeit, als die Pandemie ihre Forschung einschränkte. Die 28-jährige Französin untersucht den Einfluss des Klimawandels auf das Aussehen von Schmetterlingsflügeln und einen möglichen Zusammenhang mit der Flugfähigkeit der Schmetterlinge. Dafür vergleicht sie die Flügel von Schmetterlingen aus kälteren Regionen Deutschlands mit denen aus dem wärmeren Süden Frankreichs. Auch ihr Projekt ist auf drei Jahre begrenzt. „Meine Forschungsreise um ein Jahr zu verschieben, wäre unmöglich gewesen. Deshalb habe ich einfach Urlaub genommen, um meine Proben in Südfrankreich zu nehmen“, beginnt Anaïs die Geschichte ihres Corona-Sommers. Eine offizielle Forschungsreise hätte ihre Universität nicht gestattet. „Die Flugzeit meiner Schmetterlinge ist aber nun einmal im Juli“, sagt die Französin lachend. Sie nahm sich einen Mietwagen und fuhr los. „Es war ein großes Abenteuer“, sagt Anaïs und lacht erneut.
Im Gegensatz zur Archäologin Mette Thuesen schaffte es die Biologin trotz aller Umstände, ihre Proben zu sammeln, ist aber rückblickend enttäuscht. Sie fühlte sich allein gelassen mit ihrer Forschung. „Natürlich muss sich die Uni an die Corona-Regeln halten“, sagt Anaïs. Sie hätte sich aber an anderer Stelle mehr Entgegenkommen gewünscht: Eine Verlängerung ihrer dreijährigen Forschungsarbeit hätte den Druck nehmen können, Proben sammeln zu müssen. Mit dem Gedanken im Hinterkopf, nur noch ein Jahr für ihre Forschung zu haben, musste sie allein einen Weg finden.
Mittlerweile ermöglicht es die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die auch Anaïs‘ Projekt finanziert hat, eine Verlängerung um drei Monate zu beantragen. Ohne diese Verlängerung wäre es nicht gegangen, sagt Anaïs. „Auch das Schreiben der wissenschaftlichen Paper dauert gerade länger, da die Fachgespräche und Diskussionen mit anderen Forschern fehlen.“ Auf die Frage hin, ob sie sich in ihrer wissenschaftlichen Freiheit eingeschränkt fühlt, wägt die Biologin ihre Worte ab: „Es ist unsere Aufgabe als Wissenschaftler, neugierig in alle Richtungen zu sein. Trotzdem ist es ein Privileg, forschen zu dürfen. Unsere Arbeit ist nicht systemrelevant und hat daher keinen Vorrang. Wir dürfen uns nicht beschweren.“
„Ich mache das Programm nicht nur, um etwas Akademisches zu produzieren, sondern auch, um rauszukommen“
Auch Michael Schroeder will sich nicht beschweren – enttäuscht ist er trotzdem. Sein Forschungsprojekt scheiterte am Visum. Der 24-jährige Student hat sich auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Europa spezialisiert und vergangenes Jahr die einmalige Möglichkeit bekommen, als Stipendiat an der Peking University zu forschen. Nach seinem Bachelor in Philosophie, Wirtschaft und internationalen Beziehungen hatte er sich auf das „China Immersion Programm“ beworben, mit dem Studierende ihre Forschungsvorhaben in China umsetzen können. Sein Ziel war es, mit einzelnen Unternehmer*innen vor Ort darüber zu sprechen, wie sie den Handel zwischen der EU und China wahrnehmen, statt nur die Daten der Unternehmen zu analysieren. „Ich bezweifle, dass ich dieses Projekt noch einmal nachholen werde“, sagt Michael. Zwei Wochen vor Beginn seines Stipendiums kam die Absage. Er hatte kein Visum bekommen. „In Peking ging das Leben unter den geltenden Einschränkngen weiter“, erzählt er, „aber wir internationale Studenten kamen einfach nicht ins Land.“
Laut einer Anfrage von mehreren Grünen-Politiker*innen an die Bundesregierung sind die Kapazitäten zur Annahme und Bearbeitung von Visumanträgen in deutschen Auslandsvertretungen seit der Pandemie deutlich eingebrochen. Die Zahl der in Deutschland erteilten Visa für Forschungs- und Studierendenaufenthalte sank von mehr als 70 000 im Jahr 2019 auf etwa 43 000 im Jahr 2020.
Statt nach China zu reisen, studiert Michael nun digital von Deutschland aus. Die Universität in Peking bemüht sich, Lehre und Forschung am Laufen zu halten, aber auch finanziell kam es zu Schwierigkeiten – sein Forschungsstipendium wurde erst mit einem Jahr Verspätung ausgezahlt. Am meisten trifft Michael aber die verpasste Chance. Ein ganzes Jahr lang wollte er in China studieren und forschen, das Land erleben, Menschen kennenlernen. „Ich mache das Programm nicht nur, um etwas Akademisches zu produzieren, sondern auch, um rauszukommen.“ Stattdessen gestaltet er nun digital sein Forschungsprojekt. „Wir arbeiten an Fragebögen für Investoren und Rechtsanwälte zu deren Auffassung des chinesischen Investorrechts.“ Ein ungeplanter Perspektivwechsel. Statt den chinesischen Blick auf Europa untersucht er nun den europäischen Blick auf China.
Für Forschungsbereiche, in denen sich Ergebnisse auch mit Methoden wie Befragungen oder Datenanalysen erzielen lassen, eröffneten sich im vergangenen Jahr zum Teil auch andere Perspektiven. In der Soziologie, der Sprachforschung und der Psychologie etwa ergaben sich mit der Pandemie ganz neue Fragen. Hier konnten Forschende die Auswirkungen einer globalen Krise auf die Gesellschaft beobachten und im besten Fall dazu beitragen, Lösungen zu finden. Junge Forscher*innen wie Mette, Anaïs und Michael dagegen können nur darauf warten, wieder wirklich frei in ihrer Forschung zu sein – und versuchen, das Beste aus ihrer oft knapp bemessenen Zeit zu machen.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit der Katholischen Journalistenschule ifp entstanden. Die Autorin des Textes ist dort Stipendiatin und hat diesen Beitrag innerhalb eines gemeinsamen Projektes mit jetzt recherchiert und verfasst. Die im Rahmen des Projektes entstandenen Beiträge findest du auf der Themenseite „jetzt: Freiheit“.