- • Startseite
- • Gender
-
•
The Female Gaze: Die meisten Star-Köche sind Männer
Warum sind Star-Köche fast immer männlich und weiß?

Vergangenes Wochenende war ich bei meinem Großvater zu Besuch. Er hat kein Internet, aber einen Fernsehanschluss – den ich wiederum selbst nicht habe. Bei ihm schaue ich mir daher oft beliebige Sendungen an. Diesmal blieb ich bei einem Ranking der liebsten „Hausmannskost nach Muttis Art“ hängen. Der Reihe nach wurden die Top 10 Gerichte vorgestellt, aber keines davon wurde von einer Mutter zubereitet – geschweige denn von einer anderen Frau. Stattdessen standen immer wieder Männer am Herd.
Ein typischer Anblick in deutschsprachigen Fernseh-Kochshows. Es sind vor allem weiße Männer, die seit Jahren vor der Kamera kochen oder als Jurymitglieder die Kochkünste anderer bewerten. Sie heißen: Tim Mälzer, Steffen Henssler, Frank Rosin, Alfons Schuhbeck, Johann Lafer, Christian Rach, Mike Süsser, Ralf Zacherl, Horst Lichter, Roland Trettl, Alexander Herrmann und so weiter und so weiter. Der einzige Schwarze: Nelson Müller. Und welche Köchinnen kennt man aus dem Fernsehen? Sarah Wiener. Cornelia Poletto. Maria Groß und Meta Hiltebrand vielleicht. Sicher gibt es noch ein paar andere Namen. So bekannt wie die männlichen Kollegen sind sie allerdings nicht.




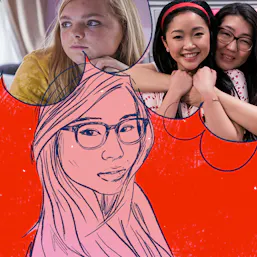








Wie kann das sein? Wo sich doch gleichzeitig so lange das Bild hielt und bei manchen immer noch hält, Frauen würden „hinter den Herd gehören“. Wie kommt es dann, dass es vorrangig weiße Männer sind, die mit Promi-Status in ihren eigenen Shows über unsere Bildschirme flimmern?
Eine Begründung liegt wahrscheinlich in den Gastronomie-Strukturen und gesellschaftlichen Bedingungen selbst. Cornelia Poletto kommentierte einmal in der Welt, dass die langen Öffnungszeiten von Restaurants schlecht mit dem Familienleben vereinbar seien. Die indisch-britische Starköchin Romy Gill sagte, dass sie ihren Beruf nur durch einen unterstützenden Ehemann ausüben konnte und die Küche als Arbeitsplatz immer noch von Sexismus und Rassismus geprägt sei.
Auch in den USA dominieren die Männer in der Fernsehküche
Nun könnte man außerdem auch argumentieren, dass Deutschland und somit die deutsche Medienlandschaft einfach nicht der Leuchtturm der Diversität ist. Ein Blick in die britische oder US-amerikanische Food-Medienbranche zeigt allerdings, dass auch hier weiße Männer dominieren. In seiner 2014 veröffentlichten Abschlussarbeit hat Journalismusdozent Evan Kropp die Geschlechterverteilung bei drei Koch-Fernsehsendern und den Shows „Top Chef“ sowie „Kitchen Nightmares“ untersucht. Er kam zum Schluss, dass Männer mehr Bildschirmzeit bekamen und Frauen und Männer jeweils stereotyp auftraten. Männliche Köche waren professionalisiert und selbstbewusst. Frauen hingegen ohne Ausbildung, emotional und anders als die Männer meist in der privaten Küche tätig.
Amerikanische Streaming-Plattformen wie Hulu oder Netflix bieten zwar mit diversen Casts und Produktionscrews mehr Abwechslung, wurden aber auch schon für die Homogenität in den Food-Programmen kritisiert. Netflix‘ Food-Aushängeschild „Chef’s Table“ wurde vorgeworfen, sich sowohl im Original als auch im Spin-Off zu stark auf weiße, männliche Köche zu fokussieren, wo es doch so viele verschiedene Geschichten zu erzählen gibt.
„Ausländisches“ Essen wird oft ohne kulturellen Kontext bewertet
Der Mangel an Diversität und somit Perspektive ist aber nicht nur ein Problem im Fernsehen, sondern scheint auch bei Printmedien oder anderen Food-Medien präsent zu sein. Und es geht eben auch nicht nur um den ungleichen Anteil von Männern und Frauen – sondern auch darum, welche Köch*innen welches Essen in den Medien wie präsentieren. Um den weißen Blick.
Erst diesen Sommer erntete die New York Times beispielsweise einen (meiner Meinung nach berechtigten) Shitstorm. Die Chefin des Südostasien-Büros Hannah Beech hatte sich vorher durch asiatische Früchte wie die Mangostan getestet – und sie eine „Übung in Enttäuschung“ genannt. Keine Ahnung, ob die gute Frau über tote Geschmacksknospen verfügt oder wie sie sonst dazu kam – Denn die Mangostan ist so ungefähr die beste Frucht der Welt und mir tun alle leid, die dieses köstliche Obst noch nie probieren konnten.
Das Problem an diesem Statement oder überhaupt Artikeln wie diesem ist der weiße Blick, der „ausländisches“ Essen oftmals ohne kulturellen Kontext einordnet und die eigene „absolute“ Bewertung aufdrückt. Geschmäcker können und dürfen variieren, aber jedes Gericht hat auch immer einen kulturellen, sogar politischen Hintergrund. Zubereitungsarten haben nicht selten etwas mit Klasse und Ressourcen zu tun. Deshalb ist es auch so bedeutsam, wer über Essen schreibt, es vor der Kamera zubereitet und bewertet.
Zuletzt ärgerte ich mich über einen kurzen Clip aus dem Frühstückfernsehen, der mir in den Twitter-Feed gespült wurde: Felicitas Then kochte Paella. Als es um die Handhabung der Garnelen ging, kommentierte die bekochte Moderatorin, dass Then die ja sogar mit den Köpfen esse, woraufhin sie antwortete, sie sei ja im früheren Leben auch Asiatin gewesen. Ein kurzer Moment, in dem die Köchin es schaffte, das Stereotyp der allesfressenden Asiaten ohne Ekel zu bedienen.
Die jetzt-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von x angereichert
Um deine Daten zu schützen, wurde er nicht ohne deine Zustimmung geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von x angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit findest du unter www.swmh-datenschutz.de/jetzt.
Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil du dem zugestimmt hast.
Als Kind von Gastro-Arbeiter*innen, Veganerin und allgemeine Snack-Liebhaberin beschäftige ich mich viel mit Essen. Essen bedeutet für mich auch Geschichte, manchmal sogar Identität. Gerade in Ostdeutschland haben Vietnames*innen jahrzehntelang „China-Imbisse“ betrieben und sich hinter Ente Süßsauer verstecken müssen. Viele von ihnen erzählten mir, dass sie nach der Wende kein Risiko eingehen wollten und der deutschen Kundschaft deshalb lieber chinesische Gerichte oder zumindest das, was man sich darunter vorstellte, servierten.
Seit einigen Jahren boomt nun aber die vietnamesische Küche. Ich halte diese Errungenschaft für das Ergebnis von mutigen Restaurantbetreiber*innen, aber auch weißer Legitimation. Ich erinnere mich daran, wie das DB Magazin Bánh mì vor ein paar Jahren zum Trendfood auserkor. Bánh mì sind grob gesagt vietnamesische Sandwiches und ein Gericht, was eine Mitschülerin mal als „komisches Brot“ bezeichnete, als ich es aus der Brotbüchse holte.
Natürlich freue ich mich, wenn sich mehr Menschen an neue Gerichte trauen, aber ich habe keine Lust darauf, dass dies in Abhängigkeit vom Wohlwollen weißer, meist männlicher Food-Kritiker und ihren Medienplattformen geschieht. Nicht-weiße Gerichte sind kein kurzlebiger Trend oder exotische Neuigkeit. Sie werden in ihren Herkunftsländern schon seit Jahren verspeist. Ich wünsche mir diverse Fernsehköch*innen und Foodjournalist*innen, um vom weißen Blick wegzukommen. So würde es gleich besser schmecken.
Du willst „Chef's Table“ sehen? Dann hier entlang zur Seite unseres Kooperationspartners Just Watch*:
*Hinweis zur Kooperation mit Just Watch: Über diese Links werden Sie auf eine Partnerwebsite weitergeleitet. Der Süddeutsche Verlag bekommt dafür in manchen Fällen eine Provision. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Berichterstattung der Redaktion.
